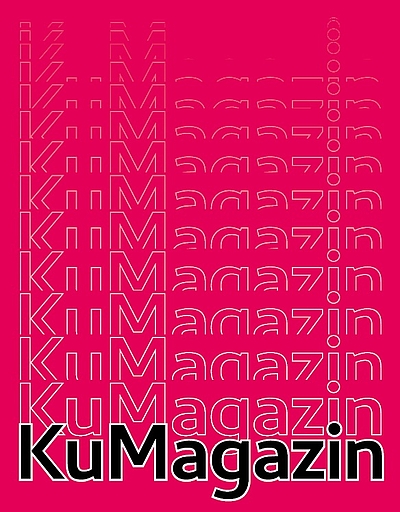Aktuelles aus dem Institut
KuMagazin – Die erste Ausgabe ist da!
Zum Beginn des Wintersemesters 2025/26 erscheint die erste Ausgabe des KuMagazin – ein freiwilliges Projekt von Studierenden des Fachbereichs Kulturmanagement an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Das Magazin widmet sich aktuellen Themen rund um Kulturmanagement, Studienprofile, internationale Erfahrungen, Projekte und Musik.
Ziel des Magazins ist es, eine Plattform für interkulturellen Austausch, Orientierung und Vernetzung im Studienalltag zu schaffen. Es richtet sich insbesondere an neue Studierende und bietet Impulse für eigene Perspektiven und kreative Neuanfänge.
Das KuMagazin entstand aus studentischem Engagement und wird ohne kommerziellen Zweck veröffentlicht. Die Beiträge spiegeln die Vielfalt und Herausforderungen einer sich wandelnden Kulturbranche wider – zwischen Digitalisierung, Förderung und Selbstorganisation.
Kolloquium zu aktuellen Fragen der Musikforschung
Das Kolloquium zu aktuellen Fragen der Musikforschung findet jeden Mittwoch um 18:00 - 19:30 Uhr statt.
Seit vielen Jahren werden in diesem Rahmen allwöchentlich unterschiedliche Fragen zu aktuellen Forschungen von Doktorand*innen und Angehörigen des Instituts präsentiert, ebenso wie Gästen aus dem In- und Ausland Raum geboten über ihre Arbeit vorzutragen.
Das Vortragsprogramm für das Wintersemester finden Sie hier.
Hellen Gross wird neue Professorin für Kultur- und Veranstaltungsmanagement

Die Studienrichtung Kulturmanagement am Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena steht künftig unter neuer Leitung. Zum 1. September 2025 übernimmt Prof. Dr. Hellen Gross den Lehrstuhl in der Nachfolge von Prof. Dr. Steffen Höhne, der 25 Jahre lang die Vermittlung seines Faches in Weimar prägte. Hellen Gross erhält ihre Ernennungsurkunde zur Professorin für Kultur- und Veranstaltungsmanagement am Donnerstag, 28. August im Roten Salon der Altenburg aus den Händen von Prof. Dagmar Brauns, Vizepräsidentin für Studium und Lehre.
„Die Professur für Kultur- und Veranstaltungsmanagement an der HfM Weimar bietet mir die einzigartige Möglichkeit, meine Leidenschaft für Forschung, Lehre und Praxis in einem inspirierenden Umfeld zu verbinden“, sagt die Wissenschaftlerin. „Ich möchte die Hochschule als zentralen Ort für wissenschaftlichen Diskurs und praxisnahe Ausbildung im Kulturbereich mitgestalten. Besonders motiviert mich die Chance, Studierende und Nachwuchswissenschaftler*innen in ihrer Entwicklung zu begleiten und gemeinsam mit regionalen wie internationalen Partner*innen innovative Impulse für den Kulturbetrieb zu setzen.“
Diese Ziele decken sich mit den Vorstellungen der Weimarer Hochschulleitung, wie die Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Prof. Dagmar Brauns, betont: „Die Hochschulleitung erhofft sich künftig eine noch engere Verknüpfung von Theorie und Praxis, insbesondere in den Bereichen Musik- und Veranstaltungsmanagement sowie die intensive, projektbasierte Vernetzung mit anderen, insbesondere künstlerischen Studiengängen der Hochschule, aber auch mit dem Studiengang Medienmanagement der Bauhaus-Universität Weimar. Wir sind davon überzeugt, mit Frau Dr. Gross genau die Richtige für diese Zielsetzung gewonnen zu haben.“
„Ich freue mich darauf, Teil einer Hochschule zu werden, die musikalische Exzellenz mit Persönlichkeitsbildung verbindet und in der Offenheit, Neugier und Innovation gelebte Werte sind. Besonders reizt mich die inspirierende Atmosphäre der Kulturstadt Weimar, die historische Tiefe mit künstlerischer und kultureller Innovationskraft vereint. Ich bin gespannt auf den Austausch, die Zusammenarbeit und die kreative Energie, die diesen besonderen Ort auszeichnen.“
In ihrer Lehre möchte sie den Studierenden ein fundiertes Verständnis für die betriebswirtschaftlichen Grundlagen des Kultur- und Veranstaltungsmanagements vermitteln sowie auch „einen kritischen Blick auf manageriale Instrumente“: „Gleichzeitig möchte ich die Studierenden für die gesellschaftliche Relevanz ihres zukünftigen Wirkens sensibilisieren. Der Fokus liegt dabei auf praxisnahen Formaten, interaktiven Methoden und der Verbindung von Theorie und Anwendung. Besonders wichtig ist mir, die Vielfalt des Kulturbetriebs abzubilden und die Studierenden zu befähigen, reflektiert, verantwortungsvoll und innovativ in diesem Feld zu agieren. Auch der Aufbau neuer Studienangebote und Module für Partnerstudiengänge wird im Fokus sein.“
Bereits während ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim fokussierte Hellen Gross sich auf das Management von Kulturorganisationen. Nach ihrer Promotion zum strategischen Management und Marketing von Nonprofit-Organisationen an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Public und Nonprofit Management von Prof. Dr. Bernd Helmig war sie als Unternehmensberaterin im öffentlichen, privaten und Nonprofit-Sektor tätig. Von 2016 bis 2021 hatte sie die Professur für Nonprofit Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes inne.
Hellen Gross verfügt durch ihre langjährige Erfahrung an Universitäten und Hochschulen über eine breite Lehrerfahrung – auch mit digitalen Lehr- und Lernformaten. Ihre Forschung beschäftigt sich mit dem strategischen Management, Marketing und dem Personalmanagement von Kulturorganisationen sowie der Kulturpolitik und ist in renommierten, internationalen Fachzeitschriften publiziert, unter anderen im Journal of Business Research, dem Journal of Cultural Management and Cultural Policy und dem International Journal of Arts Management.
Seit April 2022 leitet sie als Vorstandsvorsitzende ehrenamtlich den Fachverband für Kulturmanagementforschung, wobei ihr die Weiterentwicklung des Faches Kulturmanagement in theoretischer, empirischer und methodischer Hinsicht und die Förderung von Nachwuchswissenschaftler*innen wichtige Anliegen sind.
Verlängerung des Mandats für den „UNESCO Lehrstuhl für Transkulturelle Musikforschung“

Der Weimarer Lehrstuhl für Transkulturelle Musikforschung – „UNESCO Chair on Transcultural Music Studies“ – wurde 2017 als weltweit erster musikwissenschaftlicher Lehrstuhl in das renommierte Netzwerk der UNESCO aufgenommen. Nun hat die UNESCO in einem offiziellen Schreiben an die Präsidentin der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Prof. Anne-Kathrin Lindig, die Verlängerung dieses Mandats bis zum 30. Juni 2029 bekanntgegeben.
Der Lehrstuhl wurde auf Initiative von Prof. Dr. Tiago de Oliveira Pinto eingerichtet und hat sich seither zu einer zentralen Plattform für den internationalen Dialog über Musik als lebendiges Kulturerbe entwickelt. Mit der anstehenden Übergabe an Prof. Dr. Matthias Lewy beginnt nun eine neue Phase, in der die kollaborative Forschung und Vermittlung musikalischer Prozesse im Süd-Süd-Nord-Kontext weiter gestärkt werden.
Als eigenständiges Profil in einer breit angelegten Musikwissenschaft untersuchen die Transcultural Music Studies musikalische Darbietungen in ihren spezifischen soziokulturellen, historischen und globalen Kontexten auf Augenhöhe, unabhängig von Herkunft oder nationaler Zugehörigkeit von Musik. Feldforschung, Verfahren der Edition und Nachbereitung von Audio- sowie Videomaterialien sind u.a. Bestandteil der Erstellung von Daten.
„Collaborative Research“ mit Partnern im In- und Ausland oder Musik als „immaterielles Kulturerbe“ (im Sinne der UNESCO-Konvention von 2003) sind weitere Schwerpunkte im Studien- und Forschungsprofil. So startet zum Beispiel im Rahmen der Fortführung und Übergabe ab September 2025 an der Hochschule für Musik unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Lewy das Forschungsprojekt „Resozialisierung von Klang: Zusammenarbeit mit Kollektiven im Amazonasgebiet bei Forschung, Archivierung und Vermittlung“, welches gemeinsam mit Indigenen Musik im Zwischenraum von materieller und immaterieller Kultur zukunftsweisend untersucht.
Die Transcultural Music Studies an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar setzen somit wichtige Impulse für die Arbeit der UNESCO, national wie international. Mit ihrer interdisziplinären Ausrichtung und projektorientierten Arbeitsweise leisten Forschung und Lehre des Fachbereichs einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung und Vermittlung von Musik als lebendiges Kulturerbe.
Hierbei ist es erforderlich, in verwandten Fachrichtungen zu arbeiten sowie empirische Methoden anzuwenden. Transcultural Music Studies ist in vier Hauptbereiche unterteilt: Kulturtheorie, Musikwissenschaft / Musikforschung, Archivierung und angewandte Projekte. Auf internationalen Exkursionen erwerben Studierende wichtige Forschungskompetenzen in der Praxis. Zu den Berufsfeldern gehören u.a. internationale Kulturvermittlung, bilaterale Forschungskooperation und Kulturpolitik.
DFG-Forschungsnetzwerk bewilligt: Musik und gesellschaftliche Transformationen der Gegenwart
Das internationale DFG-Forschungsnetzwerk plant in den kommenden drei Jahren sechs Arbeitstreffen zu den Themen: Musik im Kontext ökonomischer und digitaler Transformationsprozesse; globale, soziale und politische Dimensionen von Musik im Kontext gesellschaftlicher Transformationen sowie Musik und ökologische Transformationsprozesse. Die 18 Netzwerkmitglieder stammen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden und den Fächern Musikwissenschaft, Soziologie und Kulturwissenschaften.
Projektlaufzeit: 2025-2028
Antragsteller: Prof. Dr. Martin Pfleiderer
Mitverantwortliche: Dr. Anna Schwenck, Seminar für Sozialwissenschaften, Universität Siegen
Neues DFG-Forschungsprojekt startet im September 2025: Entwicklung einer Cloud-basierten Toolbox für Notenanalysen
Das Projekt zielt auf die Entwicklung und Evaluierung einer umfassenden und benutzerfreundlichen Open-Source-Software-Toolbox für die Annotation, statistische Analyse, Visualisierung und Mustersuche in Notentexten. Durch den Einsatz neuester Computer-, Internet- und Cloud-Technologien, insbesondere der Plattform Jupyter4NFDI, soll die Toolbox zur Beantwortung einer breiten Palette von musikanalytischen Forschungsfragen der Musikwissenschaft und Musiktheorieanwendbar anwendbar sein.
Projektlaufzeit: 1.9.2025 bis 31.8.2028
Antragsteller: Prof. Dr. Martin Pfleiderer
Projektmitarbeiter: Dr. Egor Polyakov
Premiere der Familienoper "Ronja Räubertochter"
von Jörn Arnecke nach dem gleichnamigen Roman von Astrid Lindgren Libretto von Holger Potocki

Ein furchtbares Gewitter tobt, als Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, geboren wird. Während sie inmitten der Räuberbande aufwächst, zieht es sie mehr und mehr in den geheimnisvollen Mattiswald und zu dessen mysteriösen Bewohnern: den hinterhältigen Graugnomen, Rumpelwichten und grausamen Wilddruden. Eines Tages begegnet sie auf einem ihrer Streifzüge Birk, dem Sohn des verfeindeten Räuberhauptmanns Borka.
Sonntag, 25.05.2025, 16.30 Uhr, Aalto-Theater Essen
Kooperationsausstellung zum Lohengrin-Seminar

"Für deutsches Land das deutsche Schwert" - dies ist nur eine von vielen Textzeilen in Wagners Lohengrin, deren Nationalpathos heute auf anderes Gehör trifft als zur Uraufführung 1850.
In der 175-jährigen Rezeptionsgeschichte hat sich der Bezug zum ,Deutschen' im Lohengrin gewandelt, was nicht zuletzt an der Übertragung der Bühnenästhetik Wagners auf die politische Inszenierung des NS-Regimes liegt. Was im Lohengrin bereits angelegt ist, das im Dritten Reich missbraucht werden konnte, und worin die Ursachen für heutige Debatten liegen, erörtert eine Sonderausstellung, die von Studierenden der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar im Rahmen eines Kooperationsseminars mit den Richard-Wagner-Stätten Graupa unter Prof. Dr. Nina Noeske und Tom Adler erarbeitet wurde.
Kurator:innen
Anne Proft
Johanna Krebs
Carl Julius Reim
MUGI-Plattform wird langfristig gefördert

Die seit 2022 in Kooperation zwischen der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar betreute Forschungs- und Publikationsplattform „Musik und Gender im Internet“ (MUGI) wird von der Mariann Steegmann Foundation für zehn Jahre gefördert. Ein Online-Lexikon und multimediale Präsentationen tragen dazu bei, dass sich MUGI als die zentrale Anlaufstelle für alle entwickelt hat, die sich gendersensibel mit Musikgeschichte als Kulturgeschichte auseinandersetzen. Herausgegeben wird MUGI von Prof. Dr. Beatrix Borchard, Prof. Dr. Nina Noeske und Dr. Silke Wenzel. Weitere Informationen finden sich unter https://mugi.hfmt-hamburg.de.
Prof. Dr. Matthias Lewy wird neuer Professor für Transcultural Music Studies

Das Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena freut sich über sach- und fachkundige Verstärkung: Zum 1. März 2025 übernimmt Prof. Dr. Matthias Lewy die Professur für Musikwissenschaft / Schwerpunkt Transcultural Music Studies an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar.
In der Nachfolge von Prof. Dr. Tiago de Oliveira Pinto wird der vergleichende Musikwissenschaftler und Kultur- und Sozialanthropologe damit auch als „UNESCO Chair on Transcultural Music Studies“ vorgeschlagen.
„Die Berufung in eine Region mit einer so reichen musikalischen und kulturellen Tradition ist für mich nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine besondere Freude als gebürtiger Sachsen-Anhalter“, sagt Prof. Dr. Lewy, der seine Ernennungsurkunde am 12. Dezember aus den Händen von Hochschulpräsidentin Prof. Anne-Kathrin Lindig erhielt.
„Es ist mir ein zentrales Anliegen, die einzigartigen kulturellen Gegebenheiten Mitteldeutschlands mit einer globalen Perspektive zu verbinden und dabei Brücken zwischen verschiedenen musikalischen Welten zu bauen.“
Ein besonderes Herzensprojekt sei für ihn die Weiterführung des UNESCO-Chairs, der von Prof. Dr. Tiago de Oliveira Pinto etabliert wurde. „Dieses Leuchtturmprojekt genießt weltweit hohe Anerkennung und stellt eine bedeutende Verantwortung dar, die ich mit großer Hingabe übernehmen werde. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule innovative Ansätze in Forschung und Lehre zu entwickeln und internationale Impulse nach Weimar zu bringen.“
„Wir in der Musikwissenschaft sind außerordentlich froh, mit Herrn Lewy eine so kompetente und breit aufgestellte Persönlichkeit gewonnen zu haben, die mit Sicherheit in die gesamte Hochschule hinein ausstrahlen wird“, betont der amtierende Direktor des Instituts für Musikwissenschaft Weimar-Jena, Prof. Dr. Michael Klaper.
Geboren 1973 in Magdeburg, studierte Matthias Lewy im Magisterstudiengang an der Freien Universität Berlin Vergleichende Musikwissenschaft sowie Kultur- und Sozialanthropologie. Ergänzend absolvierte er ein Diplomstudium in Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.
Seine berufliche Laufbahn begann in den 2000er Jahren, als er erste Erfahrungen bei der Piranha Musik- und Verlags-AG sowie der WOMEX (Worldwide Music Expo) in Berlin sammelte. Später war er als freier Kulturmanager und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) tätig.
Ab 2005 führten ihn Forschungsaufenthalte nach Venezuela und in den Norden Brasiliens, wo er indigene Tanzgesangsrituale untersuchte. Diese Feldforschungen bildeten die Grundlage für seine Promotion an der Freien Universität Berlin. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Promotion setzte er seine wissenschaftliche Karriere als Postdoc fort und übernahm 2015 eine Professur für Musikethnologie an der Universität von Brasília in Brasilien.
Im Jahr 2019 wechselte er in die Schweiz, wo er zunächst als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Competence Center Music Education Research (CC MER) der Hochschule Luzern tätig war. 2023 wurde er dort zum Professor für Forschung und Lehre ernannt. Im darauffolgenden Jahr habilitierte er sich erfolgreich an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar und erhielt die Venia Legendi im Fach Musikwissenschaft.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Ökomusikologie, Klangontologien in Amazonien, populäre Musik Lateinamerikas und der Karibik, Musik und Politik sowie die globale Musikindustrie, insbesondere die Weltmusikszene. Darüber hinaus befasst er sich mit ethnohistorischen Quellen der Musik des Alten Mexikos und mit Archivierungsfragen in der Musikforschung.
Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit engagiert er sich im Bereich der angewandten künstlerisch-wissenschaftlichen Musikvermittlung. Als Klangkurator gestaltet er Ausstellungen in führenden ethnographischen Museen, darunter das Grassi Museum Leipzig, das Humboldt Forum Berlin und das Musée d'ethnographie de Genève.
Information zu Modulscheinen
Es wurden neue Modulscheine für das Bachelor-Kernfach Musikwissenschaft und für das Ergänzungsfach Interkulturelles Musik- und Veranstaltungsmanagement entwickelt.
Ihr findet diese auch als Download auf der MuWi-Website unter Studium > Ordnungen|Modulkataloge und auf der HfM-Homepage im Studienfinder unter Studiendokumente.
Alte Scheine und das Studienbuch behalten weiterhin ihre Gültigkeit und werden vom Prüfungsamt weiterhin akzeptiert.